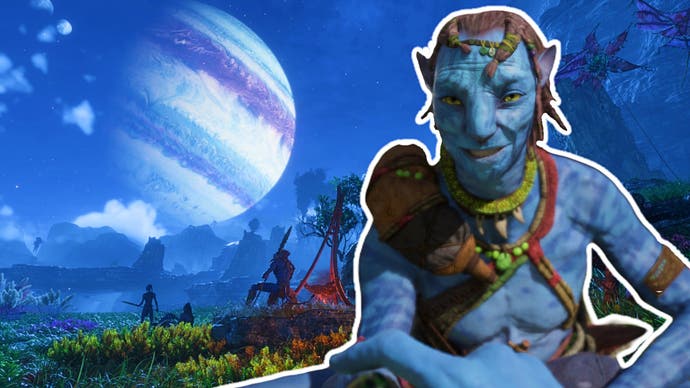Avatar: Frontiers of Pandora im Test: Ethno-Kitsch und Far-Cry-Routine in der wohl schönsten Spielwelt 2023
Na'Vi finden wir das?
Ihr habt es gut: Ihr müsst nur zwei Fragen beantworten, um zu wissen, ob Avatar: Frontiers of Pandora euch gut unterhalten wird. Erstens: Mögt ihr James Camerons Filmreihe und müsst bei der Masse an Ethno-Kitsch und seiner berechtigten, aber eher einfach gestrickten Kolonialismus- und Umweltkritik nicht mit den Augen rollen? Und zweitens: Habt ihr die Far-Cry-Formel schon satt, die hier sehr solide zum x-ten Mal reproduziert wird, diesmal nur eben in blau?
Beantwortet ihr die Fragen mit “Ja” und “Nein” – in dieser Reihenfolge! –, ist das hier ein Vier-Sterne-Spiel für die Zeit bis Weihnachten. Denn wenn mich jemand fragen würde, was man an einem Avatar-Spiel anders machen sollte, ich wüsste es wohl nicht. Das hier ist eigentlich fast genau das, was es sein musste: Eine riesige, offene Welt, mit viel “Jäger-und-Sammler”-Feeling, hohem Wiedererkennungswert zu den Filmen und eine zentrale Gameplay-Schleife mit Hand und Fuß. Ich auf der anderen Seite habe schwere Probleme, mir darüber klarzuwerden, wie ich Avatar: Frontiers of Pandora nun finde. Lest weiter und findet es mit mir zusammen heraus!
Wo fängt man bloß an?
Begeisterung für die simple Widerstands-Geschichte bringe ich jedenfalls schon mal nicht auf. Den Bösewicht erkannt man schon durch seine Atemmaske, bevor er das erste Mal den Mund aufmacht. Ich navigiere eher pflichtbewusst und im Halbschlaf durch meine Heimatbasis, die (wie immer) nur ein begehbares Crafting- und Handelsmenü ist. Und ich registriere die in dieser schwierigen Situation unpassend gut aufgelegten NPCs nicht mehr als Charaktere. Ich weiß, dass sie sich nicht in den Dienst der Story stellen, sondern nur hier sind, weil über Ubisoft-Spielen offenbar auch über Geschichten kolonialistischer Indigenen-Verdrängung eine gewisse tonale Leichtigkeit hängen muss. Mich nervt das eher, als dass es mich zum Schmunzeln anregte.
Vor allem aber ist es das, was man tut und wie, das mittlerweile einfach zu vertraut ist, um mich noch in Wallung zu bringen. Wenngleich man sagen muss, dass Avatar seinen
Fokus durchaus etwas anders setzt als Far Cry: Es ist immer noch ein Spiel, in dem man schleichend und ballernd Stützpunkte aushebt und in dem man nicht zu knapp jagt und sammelt und Skilltrees hinaufklettert, dank derer man dann Stützpunkte besser aushebt und effektiver jagt und sammelt. Ihr verbringt viel Zeit in der “Detektivsicht”, um euch von seinen Na’Vi “Instinkten” zum nächsten Missionsziel leiten zu lassen.
Ihr absolviert hier und da mal ein etwas langweiliges Hacking-Minispiel, um Container oder Türen zu öffnen, zieht Hebel, zerschießt Rohre und dreht Ventile, um Anlagen zu sabotieren und scannt die Umgebung in Ermittlungsabschnitten nach etwas zu kryptischen Hinweisen, die ihr wahllos kombiniert, bis es in der Story weitergeht. Man kennt das alles schon sehr, sehr, sehr gut. Es ist hier nur etwas lockerer strukturiert.
Weltendesign vom anderen Stern
So sind zum Beispiel die Kämpfe gegen die Invasoren von der Erde seltener, weil man nicht alle paar Meter in eine Patrouille hineinstolpert. Meistens nutzt man dann Na’Vi Waffen wie Bögen oder Speerwerfer statt die unlizenzierte AR-15 mit Flammen-Muster. Stattdessen mehr Erkundung, mehr Fährtenlesen und Früchtesammeln und – ja – auch ein bisschen staunen darüber, wie gut die Umgebung eigentlich aussieht. Tatsächlich ist ausgerechnet die Welt eine große Stärke von Avatar: Frontiers of Pandora. Jedes einzelne Biom ist eine Schönheit und die ersten Stunden dort bleibt man immer wieder stehen, um Bilder zu knipsen oder – gewagt! – einfach mal still die Umgebung auf sich wirken zu lassen.
Fliegende, bewachsene Felsen in Hunderten Metern Höhe, gewaltige steinerne, halb eingestürzte Bögen, an denen sich die Wolken kratzen. Hausgroße, fluoreszierende Pilze oder Mammutbäume lassen einem den Hals weit offen stehen. Und das passiert auch spät in die etwa 25-stündige Kampagne hinein noch immer wieder, wenn ihr die Grenzen Pandoras Stück um Stück erweitert. Und diese Sachen sehen nicht nur interessant und spannend aus, auch über Funktion und Lebenszyklus fast jedes Gewächses hat sich Massive Entertainment Gedanken gemacht. Über die meisten Pflanzen und Tiere kann man in der Instinktsicht eine Beschreibung abfragen, die ich erstaunlich oft auch las.
Manche Pflanzen verschießen ihre Samen in sichere Entfernung, sobald man sich nähert. Andere feuern Projektile auf sich bewegende Bedrohungen, bevor man sich nähern und sie ernten kann. Keine Pflanze gleicht der letzten, darin muss eine Menge Arbeit geflossen sein und Massive Entertainment gebührt eine Menge Respekt dafür. Und für jedes einzelne Stück Obst oder Gemüse gibt es ein eigenes kleines Minispiel, das bei Erfolg eine Frucht in bestmöglichen Zustand abwirft. Auf diese Weise macht man sich deutlich tiefer mit Pandora und dem Leben darauf vertraut, als in den meisten anderen Open-World-Titeln, in denen die Flora nur da ist, weil die Landschaft sonst so trostlos aussähe. Das hier wirkt dagegen sehr lebendig.
Den Baum vor lauter Wald nicht sehen
Teilweise fast schon zu lebendig. Selbst im geführten Modus, der mit Markern und Kartenvermerken auf die Sprünge hilft, verliert man vor lauter Blättern, Stämmen und leuchtenden Insekten streckenweise so sehr die Orientierung, dass man sich fragt, ob man die Quest überhaupt aktiv geschaltet hat. Ich denke, es liegt daran, dass das blaue Schimmern in der Instinktsicht des Spielers zwar zunächst die grobe Reiserichtung aufzeigt, in Suchaufträgen dann aber verschwindet, sobald man sich im großzügig gesteckten Zielbereich befindet. Handelt es sich um ein Objekt, das man einsammeln oder einen Mechanismus, den man betätigen muss, wird das Schimmern durch eine hell durchscheinende Umrandung ersetzt, die im hohen Detailgrad der Umgebungen oft untergeht. Sosehr ich die Welt also auch mochte, manchmal sah ich beinahe zu viel davon, einfach, weil mich die Wegführung im Stich ließ.
Außerdem ist es schade, dass auch all das Leben, das Massive Entertainment für das Spiel erdachte, am Ende auch nur in den Crafting-Teil einfließt und zu leistungssteigernden Gerichten wird, vor denen mein Inventar regelmäßig überlief. Die sind oft auch nötig, denn vor allem, wenn man nicht vorhat, viel zu schleichen, machen einem die Mecha der RDA schnell den Garaus, selbst auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad. Da kommt das Curry mit zehn Minuten 40 Prozent Widerstand gegen konventionellen Beschuss doch gerade recht. Nach meinem Dafürhalten war der offene Kampf dennoch nicht die feine Art, dieses Spiel zu spielen. Und überhaupt ist der Gedanke, als wandelnde Fertiggerichtetheke in die Schlacht zu ziehen irgendwie seltsam und mehr Verwaltungsarbeit, als für diese Sorte Gameplay gewöhnlich veranschlagt wird. Zumal sich die Koch-Animation nicht abbrechen lässt.
Den Baum vor lauter Wald nicht sehen
Nun denn, im Hit-and-Run oder – soweit möglich – vollem und von nicht unbedingt wahnsinnig neugierigen Gegnern gestütztem Schleicheinsatz fühlt sich das Spiel am wohlsten. Vergesst nur nicht, immer schön alle Feinde zu markieren, um immer über die Positionen der Gegner… Was? Ihr wisst, wie das läuft? Stimmt. Ihr habt ja auch ein oder mehrere Far Crys der letzten Jahre gespielt.
Ich finde auch etwas schade, dass sich nicht alle Waffen gleich gut anfühlen. Und mit “nicht alle” meine ich, dass ich gut die Hälfte der Na’Vi Waffen nicht so gerne mochte. Die Schleuder für Sprengsätze war zu situativ, als dass ich einen meiner vier Waffenslots dafür opfern wollte. Die kurze Aufladezeit des Speerwerfers war im Kampf zu schwierig zu timen und vermittelte nicht die nötige Kraft für diese so starke Waffe. Und der schnell feuernde Kriegsbogen fühlte sich irgendwie zahnlos an. Nein, ich blieb bei den beiden normalen Bögen und zielte damit immer schön auf die rot glühenden Schwachpunkte der Mecha, sobald sie sich von mir weggedreht hatten.
Interessanter wird es, sobald ihr ein paar Erinnerungen eurer Vorfahren freigeschaltet habt, wie das Spiel seine aktiven Skills nennt und die grob markiert auf der Karte versteckt sind. Einer davon lässt euch den Piloten eines taumelnden Mechs aus dem Cockpit reißen, eine andere verstärkt eine Nahkampfattacke, wenn ihr euch fallend auf den Gegner stürzt. Damit legt man schon das eine oder andere elegante und spektakuläre Kampfmanöver hin. Oft aber, wird man einfach nur über den Haufen geschossen, wenn man allzu Wildes wagt.
Avatar: Frontiers of Pandora – Fazit:
Ihr seht schon: Ich mag die Welt mehr, als ich erwartet hatte. In dieser Dichte hat sich noch nie jemand Gedanken insbesondere um die Pilz- und Pflanzenleben einer fremden Welt gemacht. Dafür gebührt Massive Applaus. Auch das bekannte Far-Cry-Gameplay funktioniert vor diesem Hintergrund ziemlich anständig. Insbesondere im Koop kann man hier seinen Spaß haben. Und doch kommt das Spiel im Ganzen in meinen Augen nicht so wahnsinnig lohnend zusammen, was ich irgendwie bedauerlich finde.
Die mechanische Seite von Frontiers of Pandora, die überall zutage tritt, sich in jedem Aspekt dieses imposanten Erlebnisses breitmacht, steht im harten Kontrast zur wundervoll organischen und vor Leben nur so sprühenden Umgebung. Es sind zwei Seiten, die nicht zusammenpassen, nicht zusammengehören – die Filme machen das zu einer zentralen Botschaft. Eine bedauerliche Ironie, dass auch das Erleben dieser bemerkenswerten Spielwelt letzten Endes darunter leidet.
| Avatar: Frontiers of Pandora | |
|---|---|
| PRO | CONTRA |
|
|